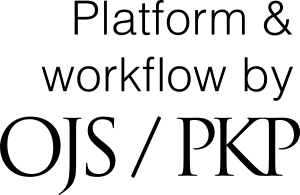Archiv
-
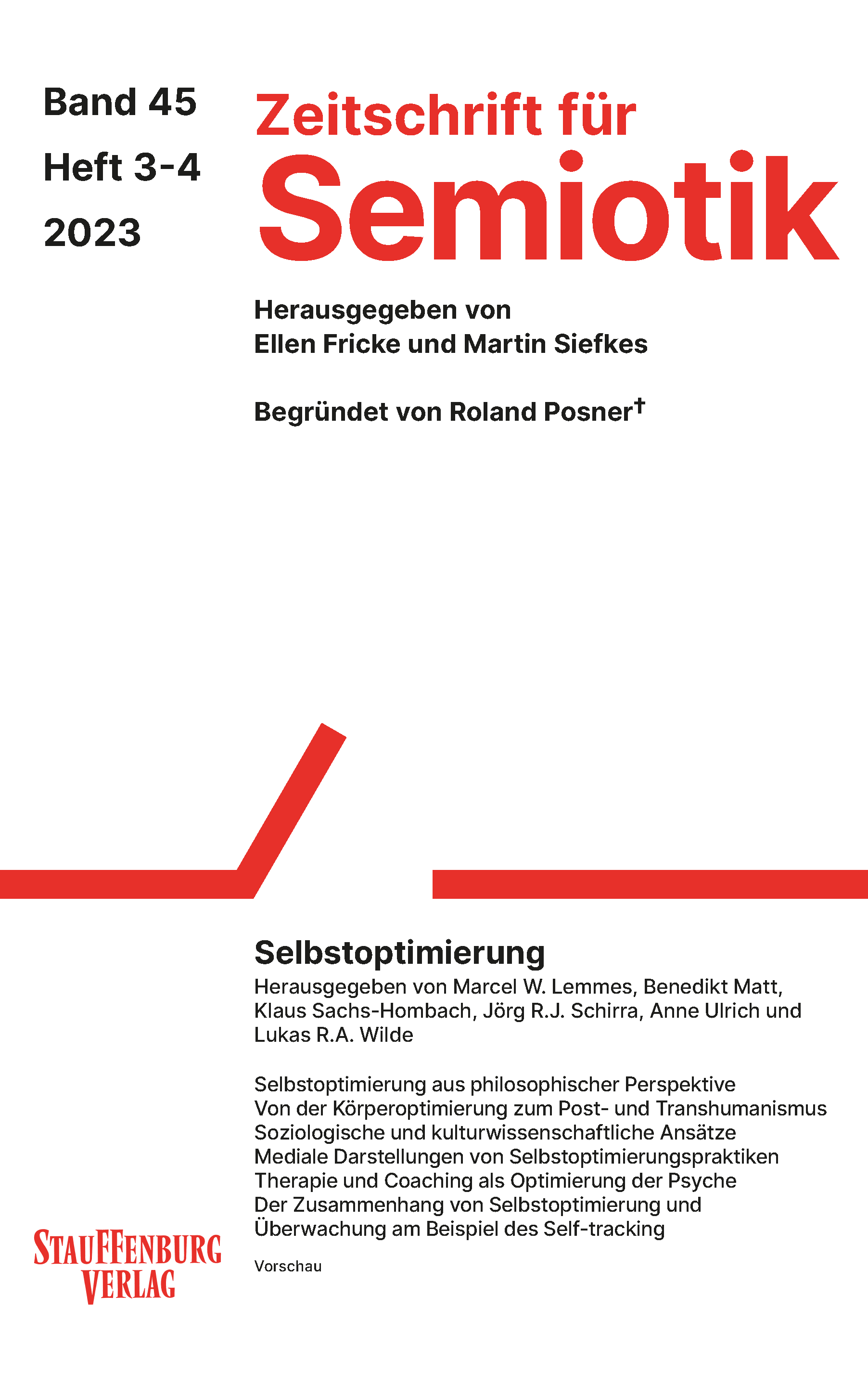
Selbstoptimierung
Bd. 45 Nr. 3-4 (2023)Dieses Heft widmet sich dem Phänomen der Selbstoptimierung aus interdisziplinärer Perspektive. Die Beiträge untersuchen historische Grundlagen, gegenwärtige Ausprägungen und zukünftige Entwicklungen eines Diskurses, der individuelle Lebensführung ebenso berührt wie gesellschaftliche Ordnungen. Im Zentrum stehen Praktiken, Technologien und Konzepte der Selbstverbesserung – von digitalen Tracking-Systemen über soziale Medien bis hin zu posthumanistischen Visionen. Dabei werden ethische, soziale und kulturelle Implikationen kritisch reflektiert. Das Heft beleuchtet, wie Selbstoptimierung zugleich Ausdruck individueller Autonomie und Instrument gesellschaftlicher Steuerung sein kann. Dabei wird die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit, Kontrolle und Verantwortung neu gestellt.
-
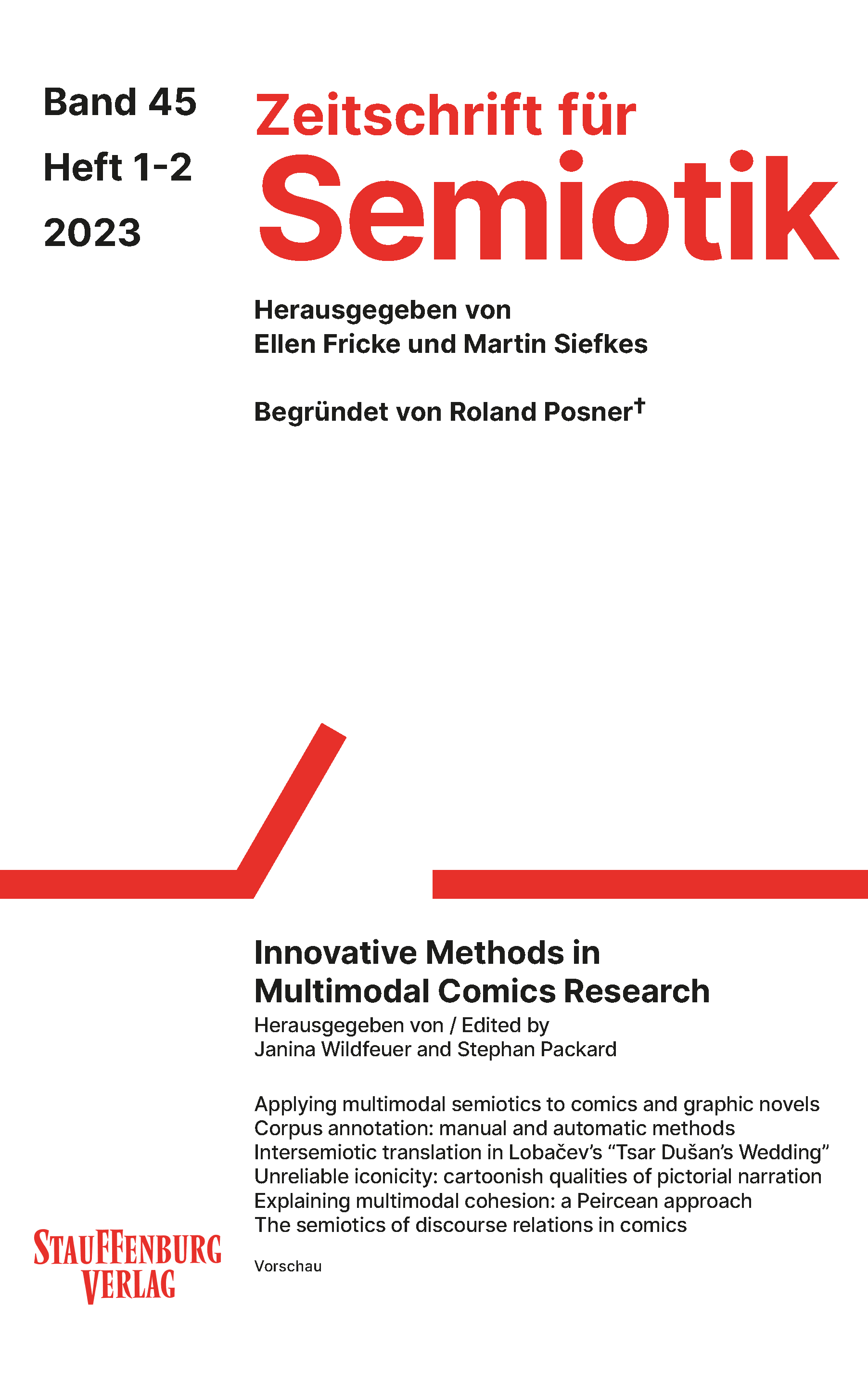
Innovative Methods in Multimodal Comics Research
Bd. 45 Nr. 1-2 (2023)Diese Sonderausgabe zu innovativen Methoden der multimodalen Comicforschung versammelt sowohl linguistische als auch inter- und transdisziplinäre Beiträge, die sich mit der semiotischen und multimodalen Komplexität von Comics, Graphic Novels und anderen Formen visueller Narrative beschäftigen. Die Beiträge knüpfen an die aktuelle Forschung an, stellen neue Herausforderungen und Lösungen vor und führen einen Dialog über verschiedene Ansätze zur Analyse der Multimodalität von Comics. In unserer Einleitung zum Heft wollen wir diese „Multimodalität des Comics“ näher beleuchten und einige Erläuterungen zu unserem Verständnis dieses Begriffs und der Entwicklung des damit verbundenen Forschungsfeldes geben.
-
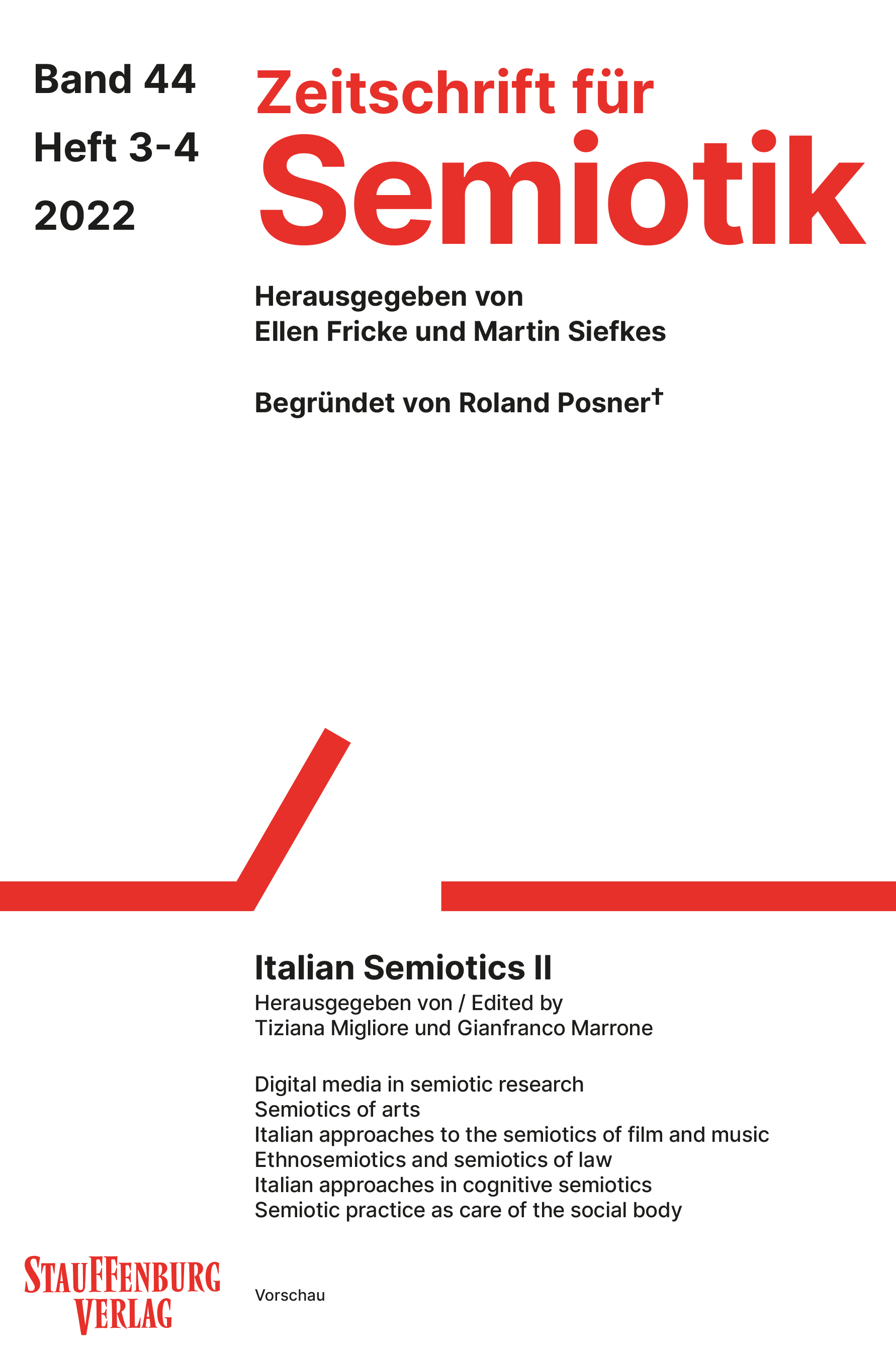
Italian Semiotics II
Bd. 44 Nr. 3-4 (2022)Der zweite Teil der zweiteiligen Ausgabe zur italienischen Semiotik richtet den Blick auf spezifische Strömungen und Themenfelder. Im Zentrum stehen Disziplinen und Anwendungsbereiche, in denen sich semiotisches Denken in Italien besonders profiliert hat – von digitalen Medien, Kunst und Film über Musik und Recht bis hin zu ethnosemiotischen, kognitiven und sozialpraktischen Perspektiven. Die Beiträge verdeutlichen, wie sich semiotische Forschung in Italien durch theoretische Weiterentwicklungen und neue gesellschaftliche Herausforderungen kontinuierlich transformiert.
-
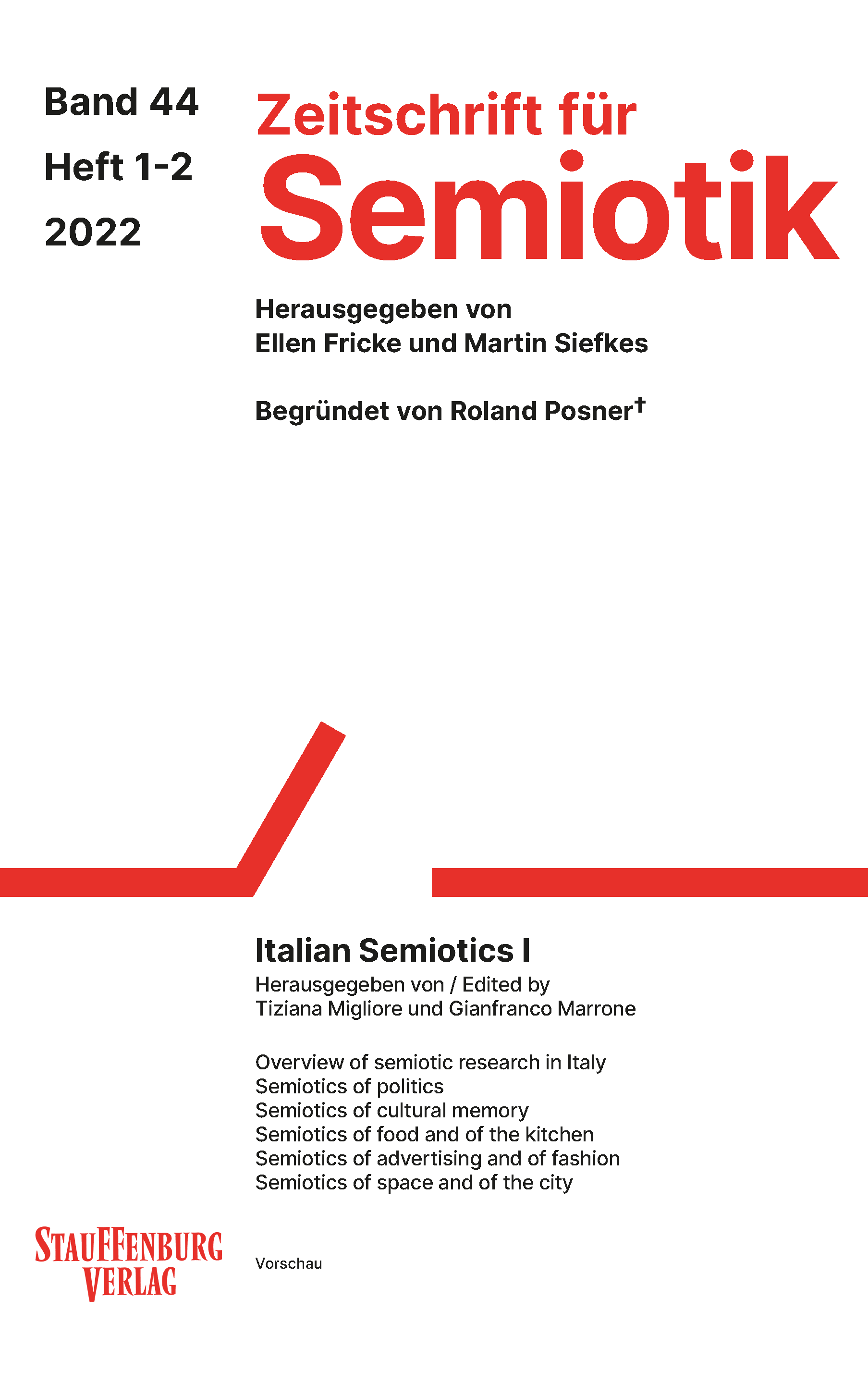
Italian Semiotics I
Bd. 44 Nr. 1-2 (2022)Dieses Themenheft bildet den ersten Teil einer zweiteiligen selbstreflexiven Untersuchung der italienischen Semiotik. Es dokumentiert die Entwicklung der semiotischen Forschung in Italien in den vergangenen Jahrzehnten und reflektiert diese kritisch. Die Beiträge zielen darauf ab, die facettenreiche konzeptionelle Landkarte und die vielfältigen Methoden abzubilden, die die italienische Semiotik geprägt haben – von der Erinnerungsforschung über Religion und Werbung bis hin zu Essen, Mode und urbanen Räumen. Durch diese unterschiedlichen Perspektiven fängt das Heft die intellektuelle Dynamik und interdisziplinäre Vielfalt ein, die die semiotische Forschung in Italien heute auszeichnen.
-
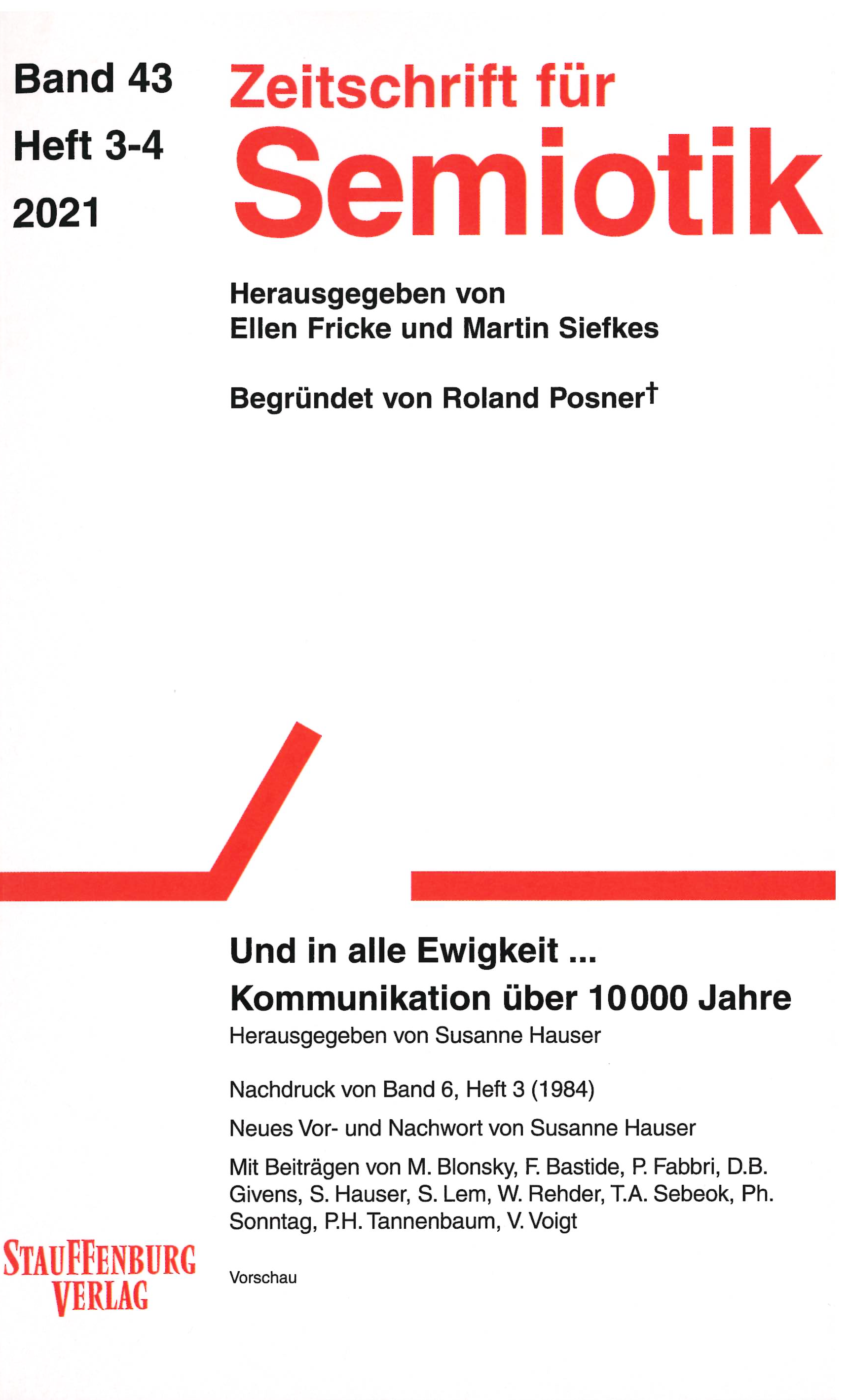
Und in alle Ewigkeit … Kommunikation über 10000 Jahre: Wie sagen wir unsern Kindeskindern wo der Atommüll liegt?
Bd. 43 Nr. 3-4 (2021)Das ursprünglich 1984 erschienene Heft 8,3 „Und in alle Ewigkeit … Kommunikation über 10 000 Jahre“ wird hier in unveränderter Form neu abgedruckt. Das Heft beschäftigt sich mit langfristigen Kommunikationsstrategien im Kontext der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Semiotische Perspektiven werden darin mit historischen, religiösen und gesellschaftlichen Praktiken verknüpft und auf ihre Tragfähigkeit für extrem langfristige Kommunikationsaufgaben hin befragt. Die Neuauflage wird gerahmt von einem neuen Vor- und Nachwort. Die digitale Ausgabe enthält nur diese neu verfassten Texte. Sie arbeiten die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf, kontextualisieren die damals vorgeschlagenen Konzeptionen und binden sie an aktuelle Diskurse an.
-
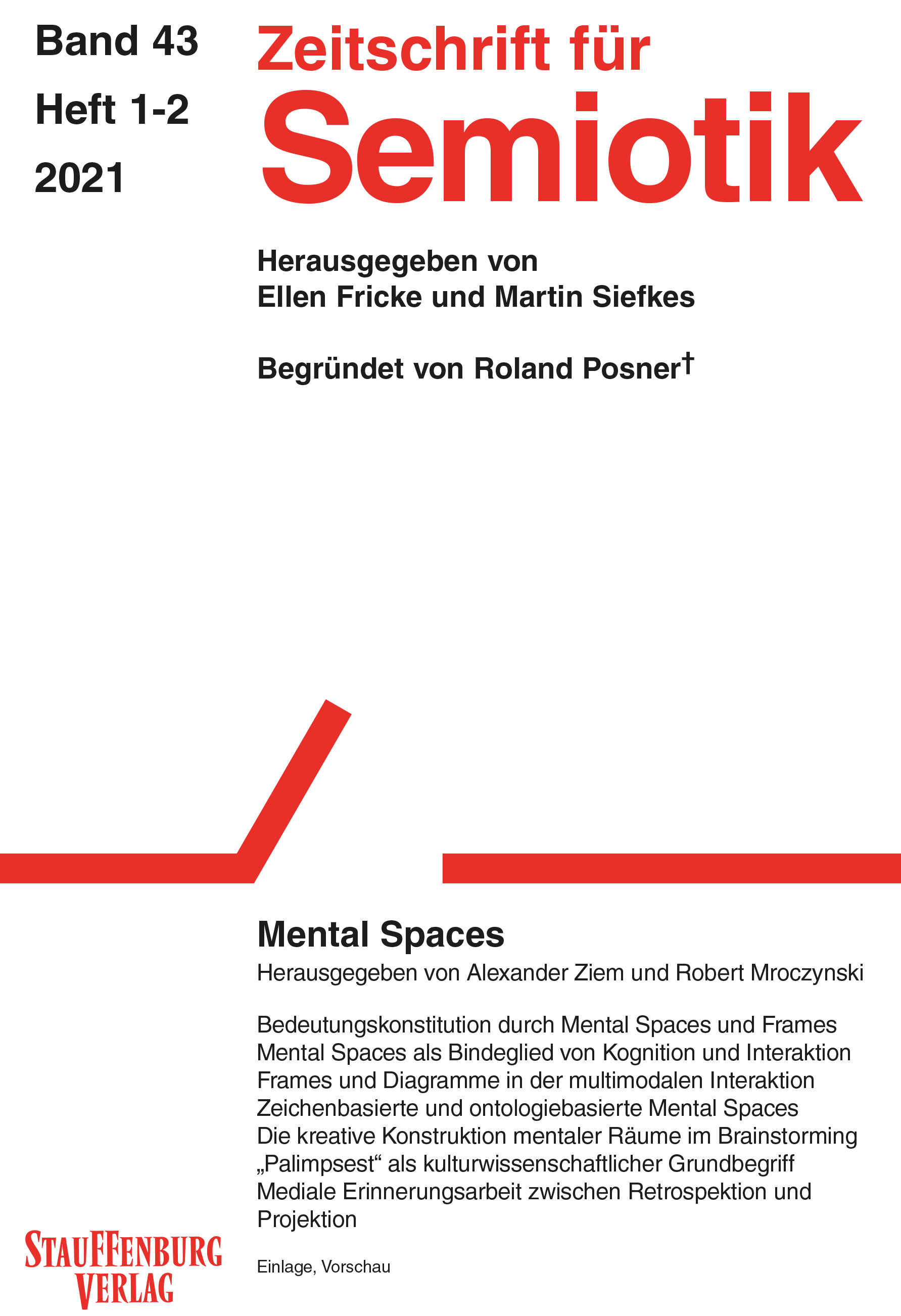
Mental Spaces
Bd. 43 Nr. 1-2 (2021)Das Themenheft beleuchtet den Prozess der Bedeutungskonstitution in der Face-to-Face-Interaktion mithilfe von kognitiven Frames und der Mental Space Theory. Unter bewusstem Verzicht auf die Gegenüberstellung von interaktionalen und kognitiven Ansätzen stellen die Beiträge eine Verbindung zwischen datenbasierter multimodaler Interaktionsforschung einerseits und kognitionssemantischen Beschreibungsansätzen und Kategorien andererseits her, wobei einige Beiträge frame-semantische Perspektiven einbeziehen.
-
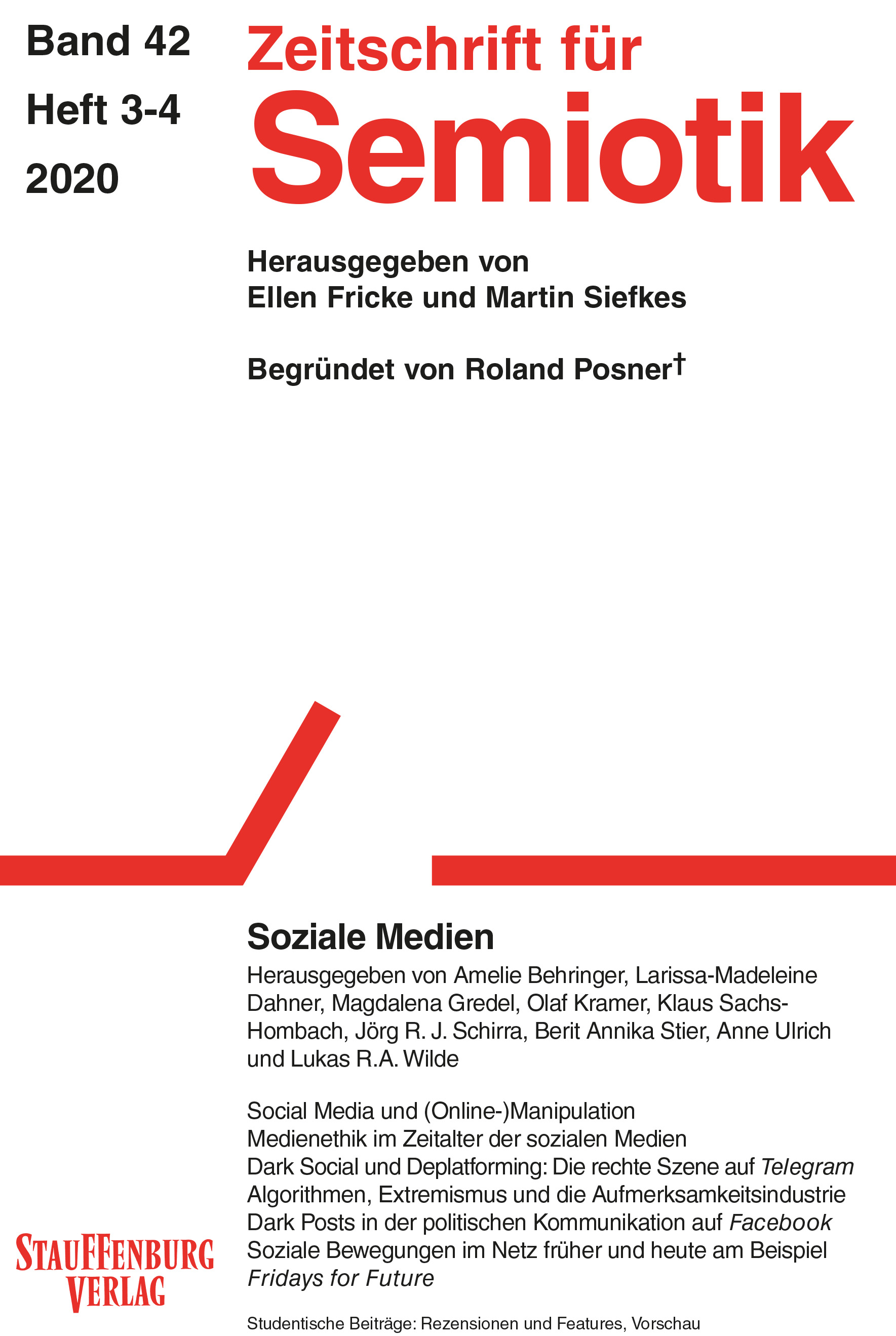
Soziale Medien
Bd. 42 Nr. 3-4 (2020)Diese Ausgabe führt Ansätze aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven zusammen, um das bestimmende Medienphänomen unserer Zeit, die sozialen Medien, in zeichentheoretischer Hinsicht zu untersuchen. Soziale Medien werden als Ort der Online-Manipulation identifiziert, Dark Posts und Deplatforming-Prozesse auf Facebook untersucht und die Verbreitung extremistischer Bewegungen auf Telegram beleuchtet. Modelle der Aufmerksamkeitsökonomie lassen sich auf den Erfolg der sozialen Medien und ihre problematische Rekonfiguration unserer sozialen und kommunikativen Prioritäten anwenden. Es werden jedoch auch positive Aspekte sozialer Medien hervorgehoben, wie etwa die Chancen für soziale Bewegungen, die Verbreitung kritischer Perspektiven und das Potenzial für die Selbstorganisation marginalisierter Gemeinschaften.
-
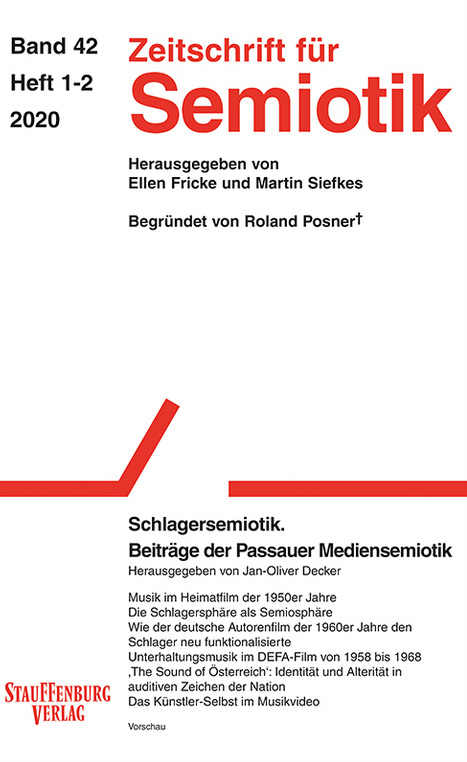
Schlagersemiotik. Beiträge der Passauer Mediensemiotik
Bd. 42 Nr. 1-2 (2020)Das Heft widmet sich aus verschiedenen disziplinären und theoretischen Perspektiven dem Schlager als einer Untergattung der (primär deutschen) Volksmusik, die nicht ohne Bezug zu filmischen Zeichensystemen sowie gesellschaftlichen, vor allem auch national orientierten Bedeutungskonstruktionen zu verstehen ist. Die semiotische Perspektive ermöglicht eine tiefgreifende Analyse der Einbettung und Funktionen des Schlagers in der deutschsprachigen Kultur, insbesondere im Film und Unterhaltungsbereich, wobei ein besonderer Fokus auf den ersten Nachkriegsjahrzehnten liegt. Die Beiträge beleuchten unter anderem die Rolle des Schlagers bei der Angleichung individueller Wünsche an kollektive Bedürfnisse in der DDR, die Darstellung einer idealisierten Welt in westdeutschen Nachkriegs-Schlagerfilmen, die flexible Anpassung des Schlagers an kulturellen Wandel und die überraschenden Funktionen des Schlagers im Autorenfilm der 1960er Jahre.
-
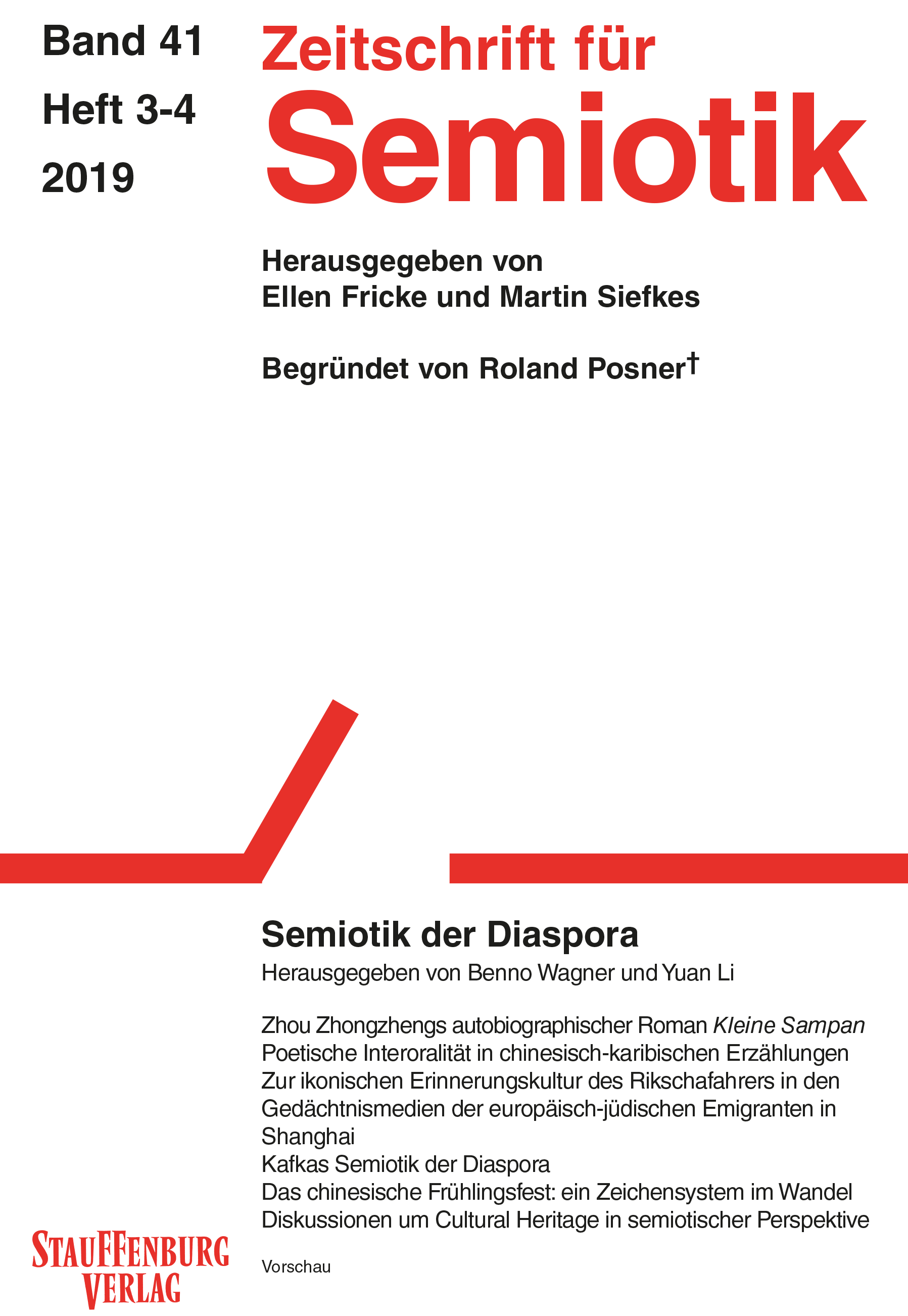
Semiotik der Diaspora
Bd. 41 Nr. 3-4 (2019)Das vorliegende Themenheft widmet sich der Semiotik der Diaspora und beleuchtet die vielschichtige Beziehung zwischen literarischer, diskursiver und rhetorischer Zeichenproduktion im Kontext von Erfahrungen der Diaspora, des Exils und der Migration. Die Beiträge in diesem Heft erforschen die Auswirkungen unterschiedlicher Migrations- und Landungs-Erfahrungen auf die Narrative und konstruierten Identitäten diasporischer Gemeinschaften. Die Beiträge beleuchten anhand verschiedener Textgattungen und historischer Kontexte semiotische Prinzipien kultureller Identitätskonstruktion, Exilerfahrungen und Hybridität innerhalb der Diaspora wie im Blick auf diese. Deutlich wird, dass entsprechende Zeichensysteme weit über Diaspora-Communities hinaus in die Mehrheitsgesellschaften hineinwirken und unsere globalisierte Welt grundlegend beeinflussen.
-
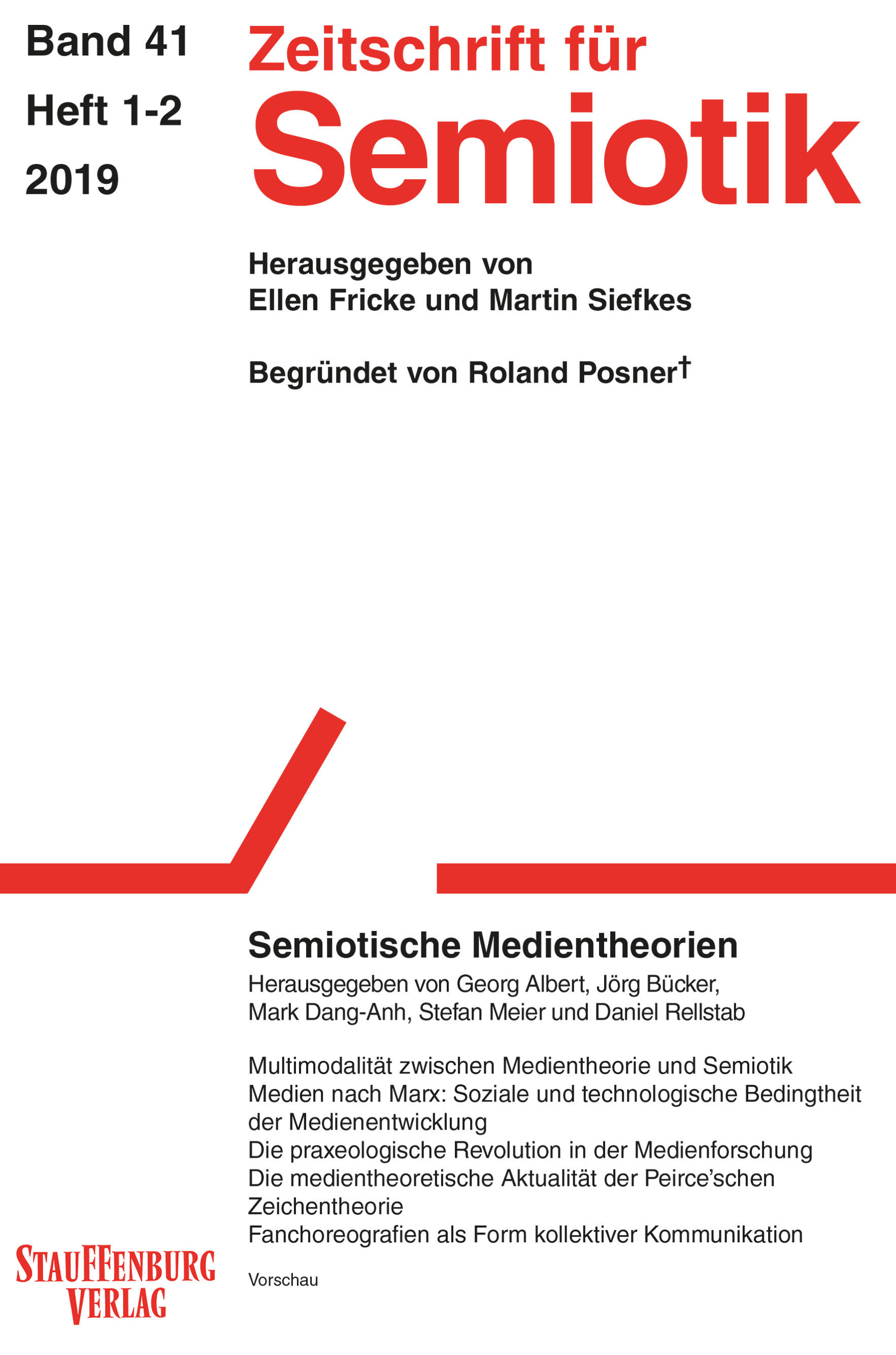
Semiotische Medientheorien
Bd. 41 Nr. 1-2 (2019)Das Heft stellt Ansätze an der Schnittstelle zwischen Semiotik und Medienwissenschaft vor, die das Verhältnis von Zeichensystemen, Medien und Kommunikationssituationen untersuchen. Die Beiträge reflektieren die theoretischen und methodischen Grundlagen semiotischer Medientheorien, und ergänzen dies durch verschiedene empirische Studien. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Analyse multimodaler Phänomene und die wachsende Relevanz praxeologischer Ansätze gelegt. Durch die Integration verschiedener Disziplinen und methodischer Ansätze verbinden die Beiträge dieses Heftes unterschiedliche theoretische und empirische Stränge der semiotischen Medientheorie und fördern einen fruchtbaren interdisziplinären Dialog.
-
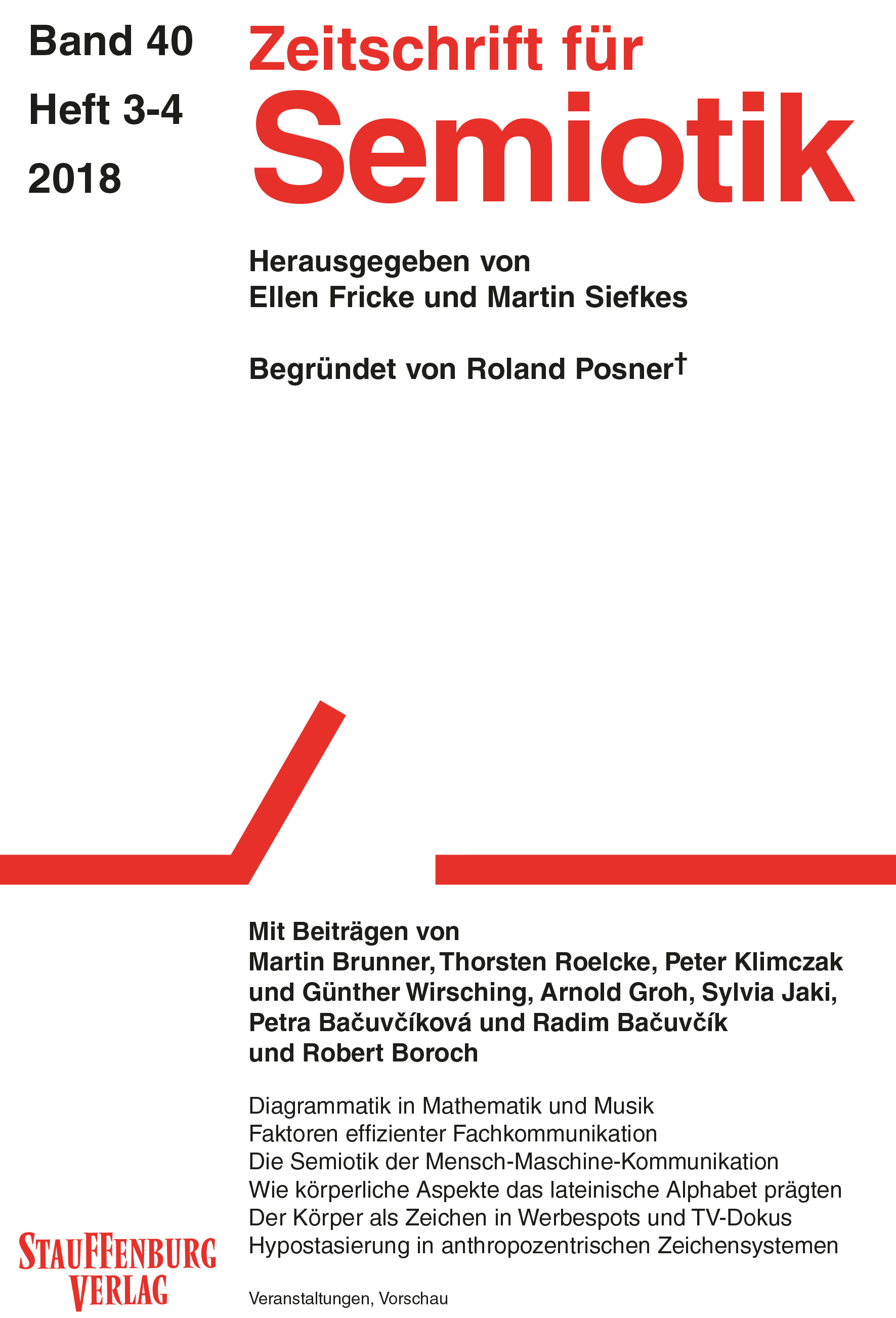
Themenoffenes Heft
Bd. 40 Nr. 3-4 (2018)Diese Ausgabe untersucht eine Reihe von Themen innerhalb der Bereiche Semiotik, Kommunikation und Medienwissenschaft. Einzelne Beiträge beschäftigen sich mit dem diagrammatischen Denken in Mathematik und Musik, den Bedingungen effizienter Fachkommunikation, und die Semiotik des maschinellen Lernens in Sprachassistenzsystemen. Darüber hinaus wird der Einfluss von Körperlichkeit auf die Entwicklung des Alphabets, die Darstellung von Wissenschaftler*innen in TV-Dokumentationen und die Rolle des Lachens in Fernsehwerbung untersucht. Weitere Beiträge untersuchen die Hypostasierung in anthropozentrischen Zeichensystemen und den Einfluss digitaler Medien auf soziale Interaktionen. Jeder Artikel bietet einzigartige Einblicke in die Konstruktion und Kommunikation von Bedeutung in verschiedenen Medien und Kontexten.
-
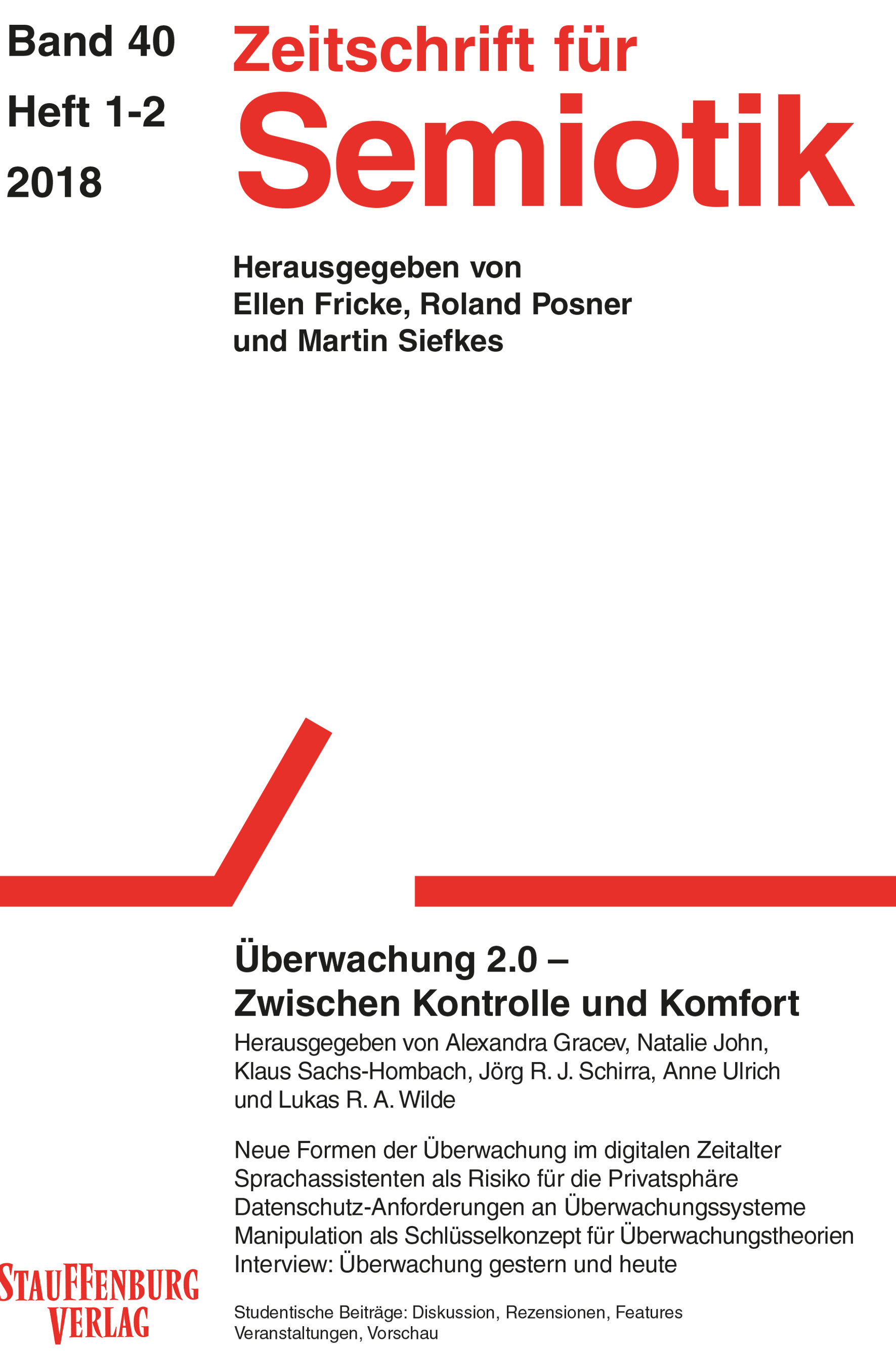
Überwachung 2.0 – Zwischen Kontrolle und Komfort
Bd. 40 Nr. 1-2 (2018)Überwachung und Kontrolle sind grundlegende soziale Praktiken in modernen Gesellschaften, sowohl in autokratischen Systemen wie auch in Demokratien. In diesem Heft werden die verschiedenen Dimensionen der Überwachung, der Risiken für die Privatsphäre und der Kontrolle im Zusammenhang mit digitalen Technologien untersucht. Es werden historische und theoretische Perspektiven untersucht, wobei der Schwerpunkt auf Foucaults Panoptikum-Modell und neuen Formen der digitalen Überwachung, wie algorithmischen Methoden zur Steuerung von Verbraucherverhalten und Vernetzung auf sozialen Medien. Ebenfalls behandelt werden neue Formen der (Selbst-)Überwachung durch Apps und soziale Medien, Veränderungen in der gesellschaftlichen Einstellung zur Privatsphäre und die Darstellung von Überwachung in Filmen und Fernsehserien.
-
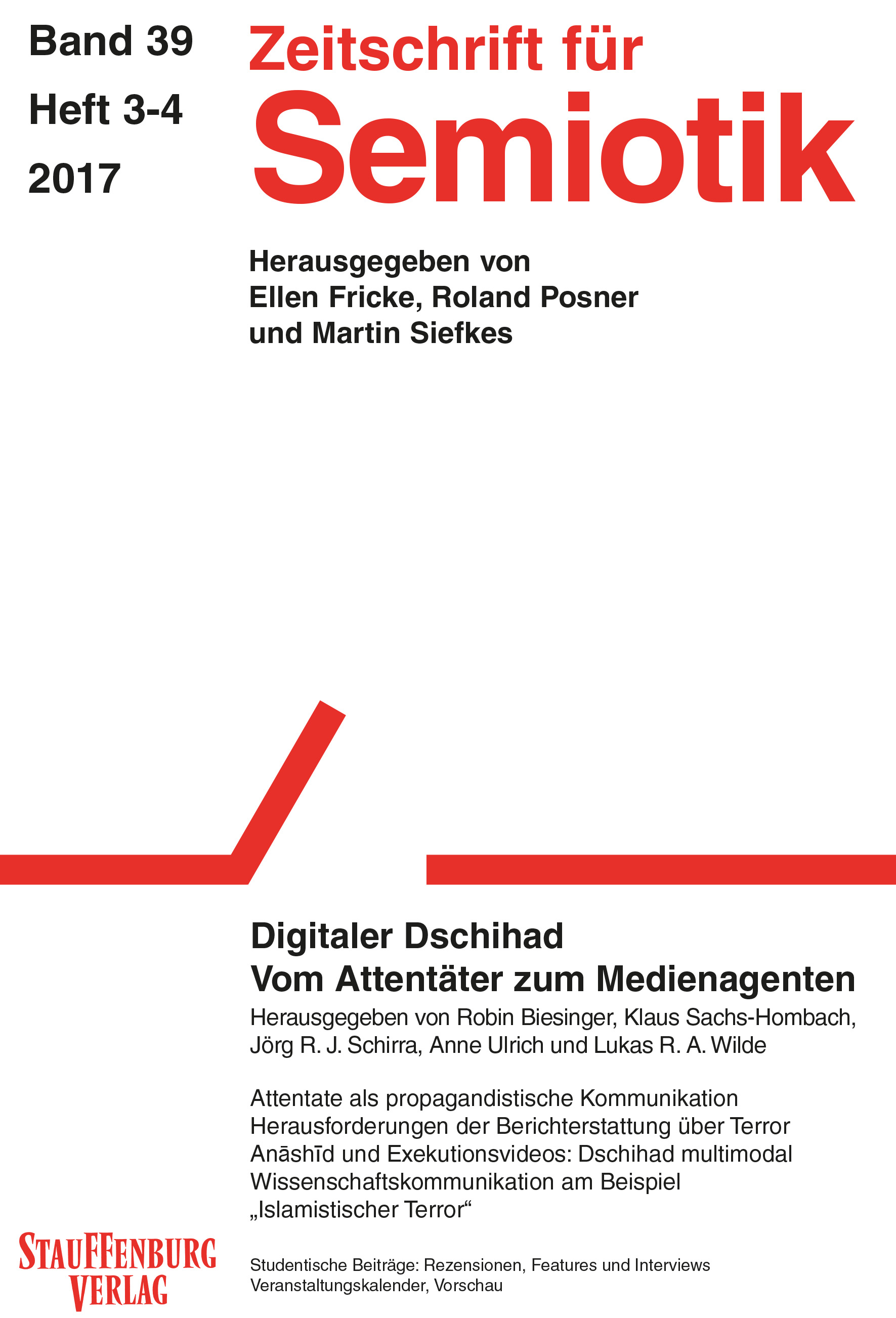
Digitaler Dschihad. Vom Attentäter zum Medienagenten
Bd. 39 Nr. 3-4 (2017)Das Heft beschäftigt sich mit den medialen Propagandastrategien des islamischen Terrorismus und Fundamentalismus. Die Beiträge untersuchen audiovisuelle Propagandaformaten des sog. Islamischen Staats (IS), der Einsatz medialer Techniken verschiedener Professionalitätsgrade, die rhetorischen Wirkungsmechanismen der multimodalen Propaganda-Kommunikate, und Möglichkeiten der angemessenen Wissenschaftskommunikation über das Thema Islamischer Terrorismus.
-
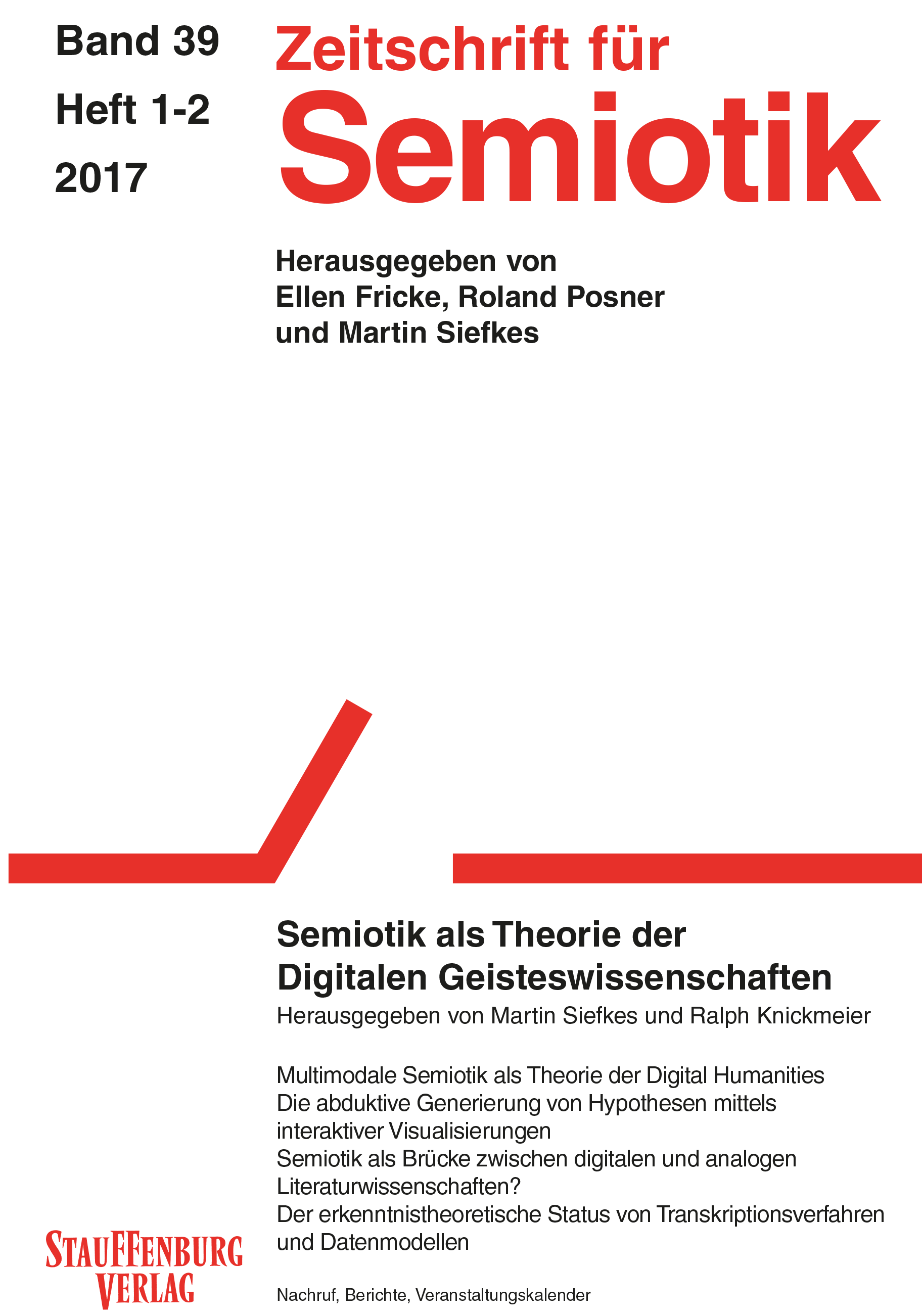
Semiotik als Theorie der Digitalen Geisteswissenschaften
Bd. 39 Nr. 1-2 (2017)Die Digitalen Geisteswissenschaften (engl. Digital Humanities) bilden einen dynamischen Forschungsbereich an der Schnittstelle zwischen geisteswissenschaftlichen Forschungsfragen und angewandter Informatik. Kann die Semiotik dazu beitragen, dieses methodologisch höchst innovative Forschungsfeld auch theoretisch besser zu untermauern? Die Beiträge des Hefts prüfen anhand ausgewählter Fragestellungen den Mehrwert semiotischer Theoriebildung für die Reflexion und Weiterentwicklung der in den Digital Humanities entstehenden neuen Zugriffsweisen auf komplexe multimodale Texte und Interaktionsformen.
-
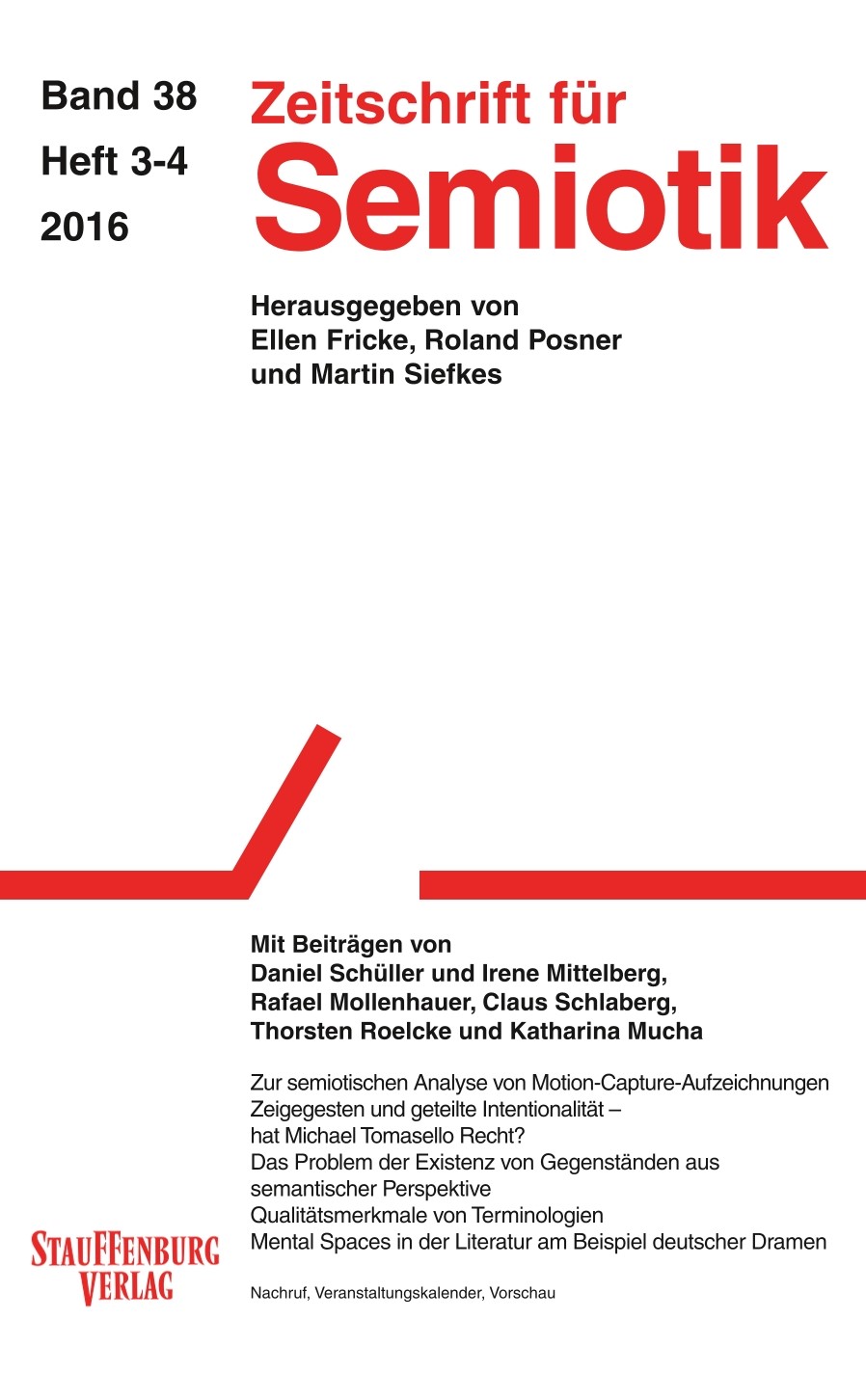
Themenoffenes Heft
Bd. 38 Nr. 3-4 (2016)Dieses themenoffene Heft vereint Beiträge der theoretischen und empirischen Gestenforschung, die in ihrem Bezug zu semiotischen und anthropologischen Theorien untersucht werden, der wahrheitsfunktionalen Semantik in der Tradition von Alfred Tarski, Forschung zu fachsprachlichen Terminologien und der Erforschung historischer Dramen mithilfe von Ansätzen der kognitiven Linguistik.
-
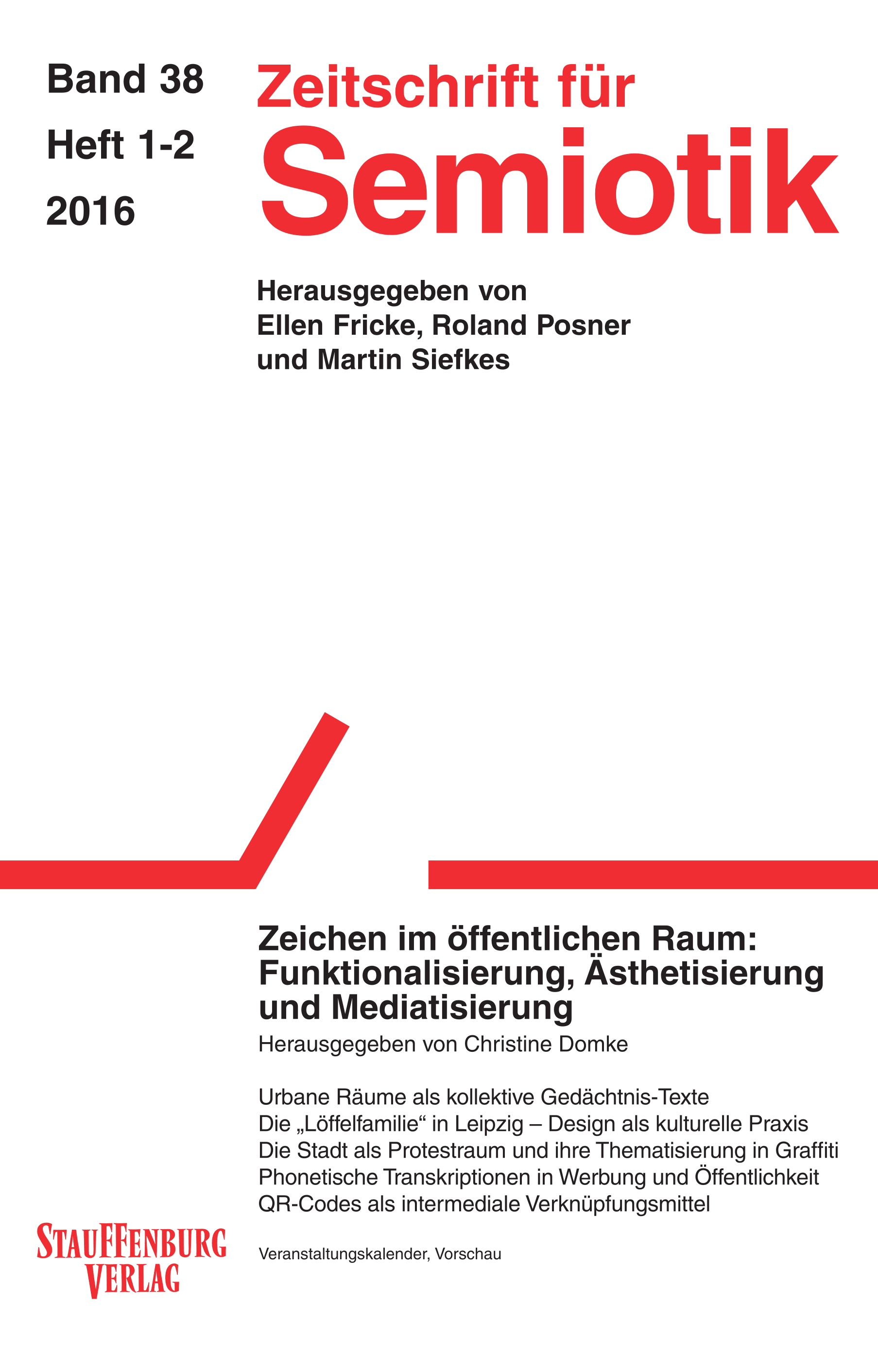
Zeichen im öffentlichen Raum: Funktionalisierung, Ästhetisierung und Mediatisierung
Bd. 38 Nr. 1-2 (2016)Das Heft beschäftigt sich mit semiotischen Aspekten der Metropolenforschung. Urbane Zeichen reichen von Verkehrszeichen und Straßennamen über Denkmäler, Street Art und Werbung bis hin zu semiotischen Aspekten von Architektur und Stadtgestaltung. Die Beiträge des Hefts beschäftigen sich u.a. mit der Erinnerungskultur von Denkmälern und Straßennamen, der sich verändernden ästhetischen Wahrnehmung von Leuchtreklamen, politischer Protestkommunikation, phonetischen Transkriptionen in Graffiti und Werbung sowie QR-Codes als Verknüpfung von städtischen und digitalen bzw. virtuellen Räumen.
-
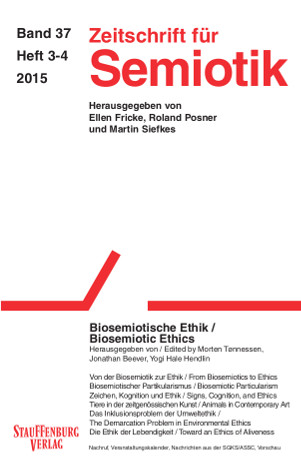
Biosemiotische Ethik
Bd. 37 Nr. 3-4 (2015)Das Heft stellt das dynamische Forschungsgebiet der biosemiotischen Ethik vor. Diese Forschungsrichtung argumentiert ausgehend von biosemiotischen Grundlagen, dass Zeichengebrauch eine ethisch relevante Eigenschaft ist, da sie Verständigung und Kooperation erst möglich macht. Da alle Lebewesen in der einen oder anderen Form Semiose betreiben, kann Menschen, Tieren, Pflanzen und sogar Ökosystemen mit diesem Argument ein moralischer Status zugeschrieben werden. Die biosemiotische Ethik öffnet den Weg zu einer Perspektive, die ökologisches Denken mit ethischen Prinzipien verbindet.
-
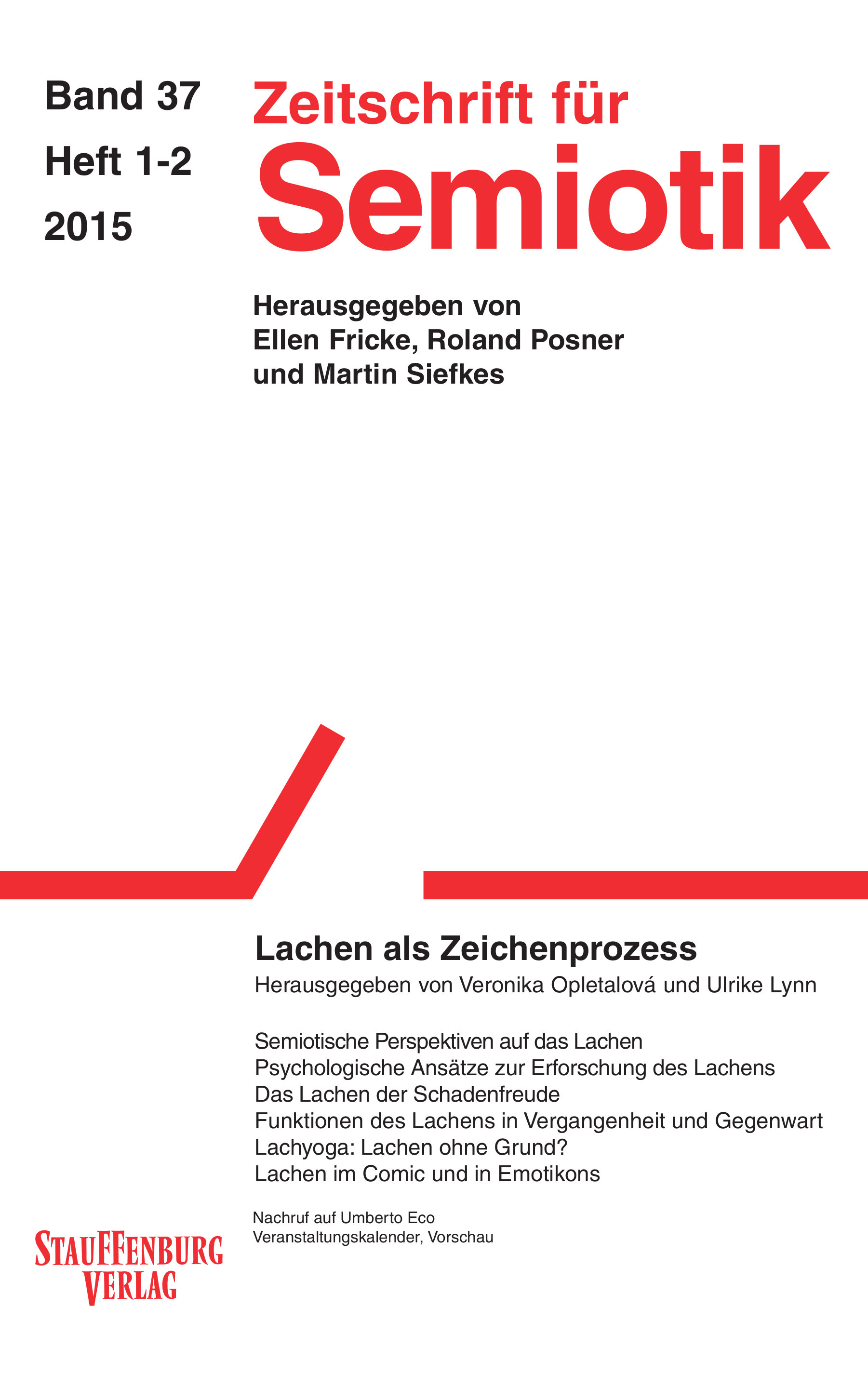
Lachen als Zeichenprozess
Bd. 37 Nr. 1-2 (2015)Das Heft „Lachen als Zeichenprozess“ untersucht Lachen aus verschiedenen disziplinären Perspektiven als ein semiotisches Phänomen mit unterschiedlichen kommunikativen Funktionen. Es gibt einen Überblick über die Lachforschung und verbindet dabei Ansätze aus Psychologie, Sprachwissenschaft, Philosophie, Comicforschung und anderen Gebieten, die Lachen als (im weiten Sinne) zeichenhaftes Phänomen begreifen und in seinen psychologischen, historischen, literarischen und kulturellen Dimensionen untersuchen.
-
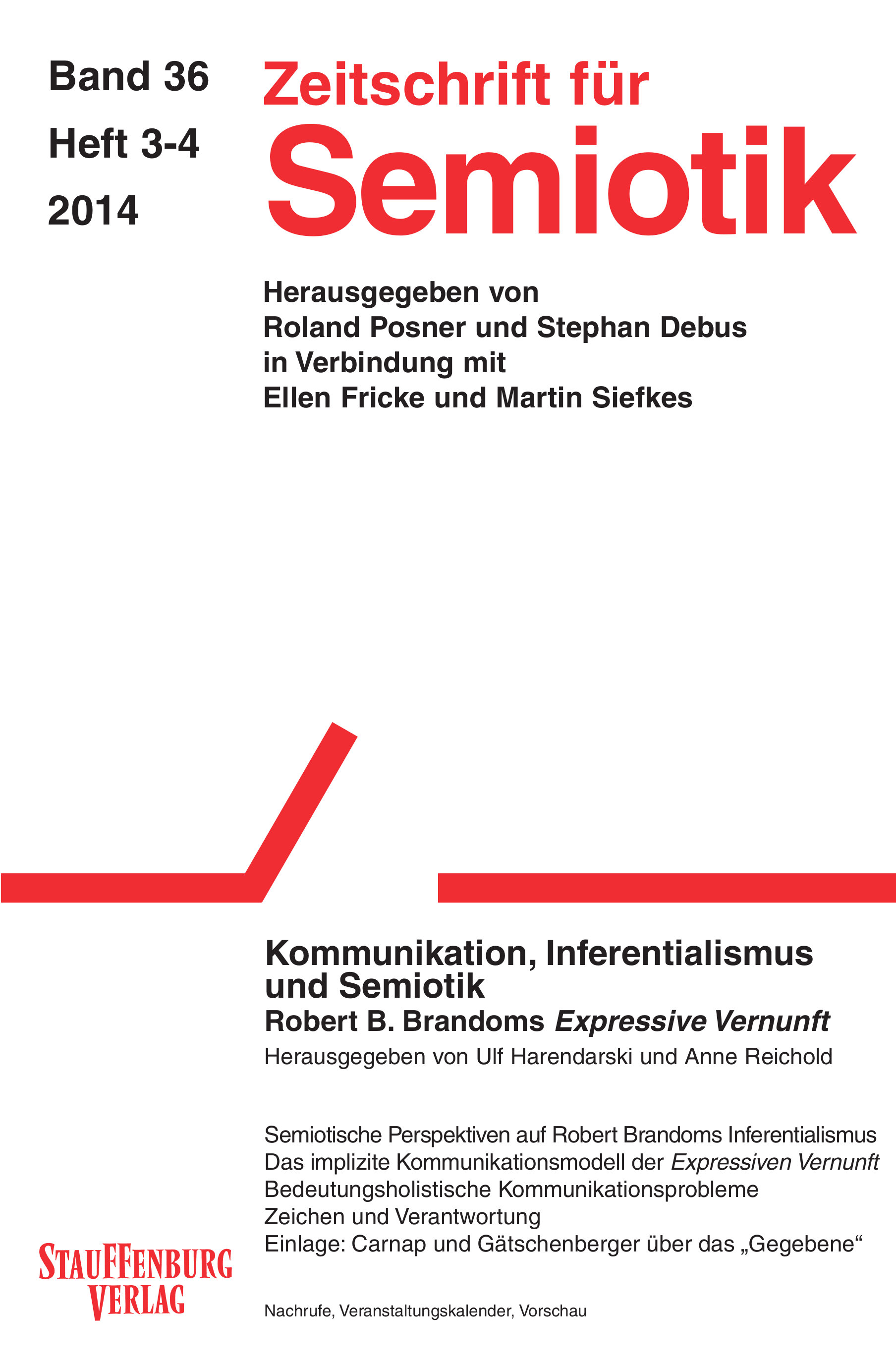
Kommunikation, Inferentialismus und Semiotik. Robert B. Brandoms „Expressive Vernunft“
Bd. 36 Nr. 3-4 (2014)Das Heft widmet sich dem philosophisch-linguistischen Pragmatismus, den Robert B. Brandom in seinem Werk Expressive Vernunft (Making It Explicit) entwickelt hat. Aus verschiedenen Perspektiven untersuchen die Beiträge des Hefts dieses einflussreiche sprachphilosophische Paradigma im Hinblick auf seine Anschlussfähigkeit zu semiotischen Fragestellungen.