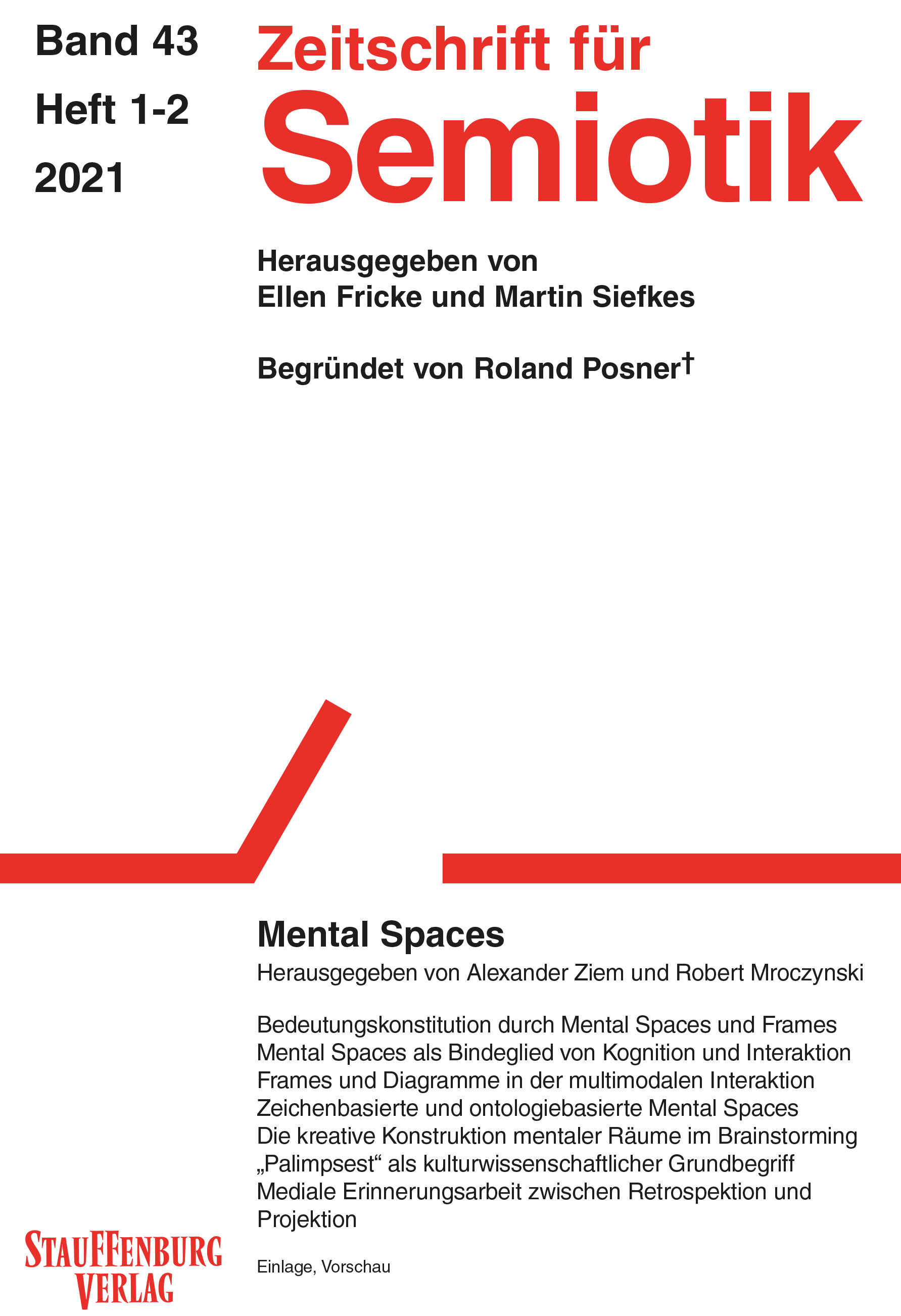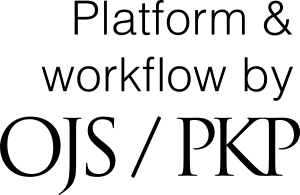Bedeutungskonstitution als Zusammenspiel zwischen Kognition und Interaktion
DOI:
https://doi.org/10.14464/zsem.v43i1-2.736Schlagworte:
Konversationsanalyse, Kognitive Linguistik, Kognition und Sprache, Interaktion, Gesprächsanalyse, Bedeutungskonstitution, Kognitive Semantik, Politische Talkshow, Mentale Räume, Conceptual Blending TheoryAbstract
Die Gesprächsforschung und die kognitive Semantik werfen ein unterschiedliches Licht auf das Phänomen der Bedeutungskonstitution. Während es in der ethnomethodologisch orientierten Konversationsanalyse bei der Bedeutungskonstitution um empirisch nachweisbare, interaktiv hergestellte soziale Wirklichkeit geht (vgl. Heritage 1984: 232), ist die kognitive Semantik bemüht, die mentalen Prozesse des Individuums beim Verstehen sprachlicher Äußerungen zu modellieren. Von dem Befund ausgehend, dass die kognitionssemantische Perspektive auf die semantische Emergenz im Rahmen von gesprächsanalytischen Untersuchungen unterbelichtet ist, kommtes in diesem Beitrag zur Verbindung eines kognitionssemantischen Modells – der Blending-Theorie nach Fauconnier und Turner (vgl. 1998: 134ff.) – mit dem konversationsanalytischen Ansatz, der insbesondere durch die Arbeiten von Sacks u.a. (1974) und Clark (1996) geprägt ist.1 Damit betritt der Aufsatz kein absolutes Neuland: Bereits Liebert (1997), Deppermann (2006, 2007), Ehmer (2012), Hougaard (2008), Oakley und Coulson (2008) und Cienki (2008) haben den Versuch unternommen, Interaktion mit Kognition zu verbinden und dabei gezeigt, dass Synergieeffekte zwischen den konversationsanalytischen und kognitiven Ansätzen bestehen (vgl. Deppermann 2006: 11ff.; 2007; Liebert 1997: 180ff.; Ehmer 2012). Dieser Beitrag soll an Ausschnitten aus einer politischen Talkshow einige dieser synergetischen Berührungspunkte aufzeigen und ebenfalls auf die aus der hier vorgenommenen Synthese sichtbar werdenden Probleme hinweisen.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2024 Robert Mroczynski

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.
Copyright for articles published in this journal is retained by the authors. The content is published under a Creative Commons Licence Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). This permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is otherwise in compliance with the licence.